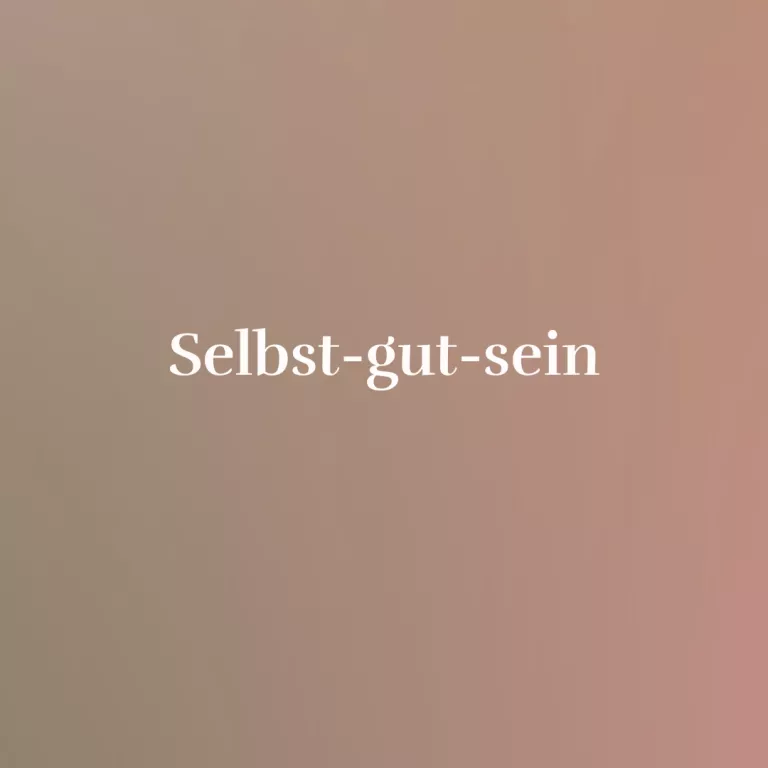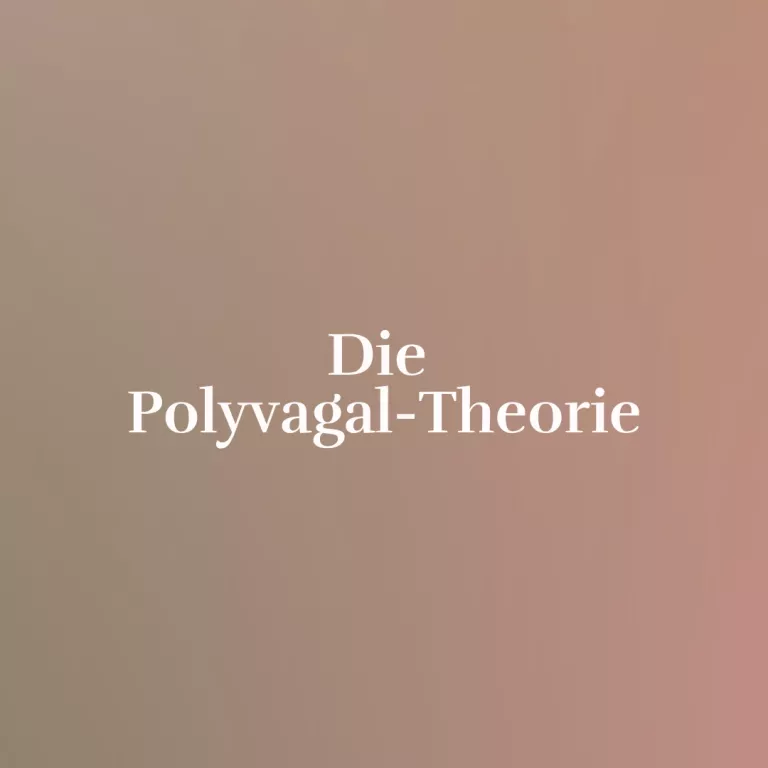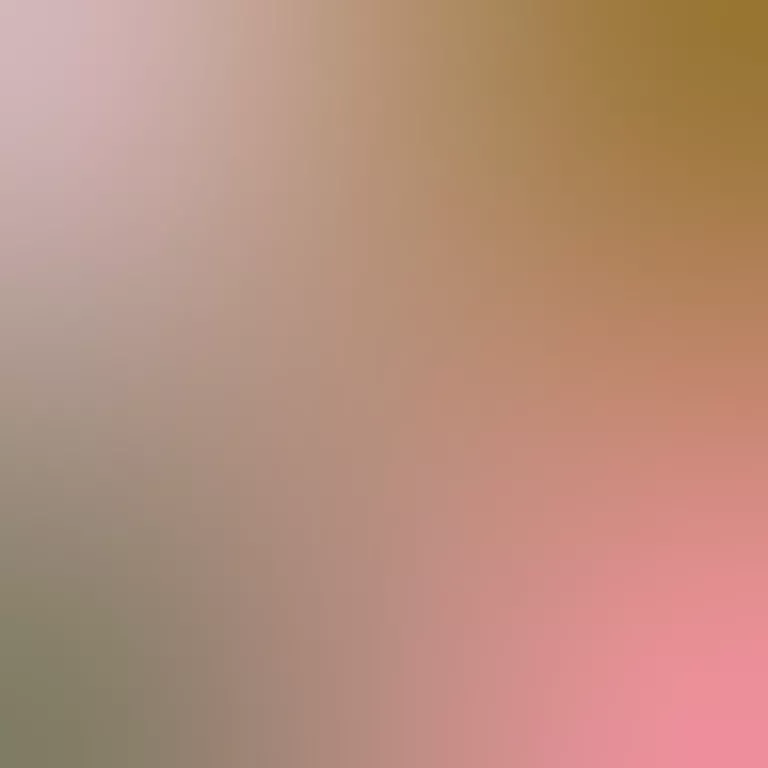«Adolescence» polarisiert und beschäftig. Was geht in einem jungen Menschen vor, der eine Mitschülerin ermordet und dies lange leugnet? Die Serie zieht sogar auf politischer Ebene ihre Kreise. Was für mich meisterhaft dargestellt, aber im Nachgang zu wenig diskutiert wird, ist die Bedeutung und Auswirkung von Zurückweisung und fehlender sozialer Zugehörigkeit auf unser gesamtes Verhalten. Eine polyvagal-informierte Perspektive.
In diesem Beitrag
- Die Serie
- Die Incels-Bewegung
- Meine Schlüsselszene
- Fehlende Zugehörigkeit
- Soziale Zurückweisung ist eine gefühlte Lebensgefahr
- Zwischen Angriff und Rückzug
- Wir müssen über soziale Zurückweisung mehr reden
- Zugehörigkeit erlebbar machen
*********** Im nachfolgenden Beitrag gibt es Hinweise zum Handlungsverlauf der Serie #spoiler *******************************
Die Serie
«Adolescence» hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer der meist gesehenen Netflix-Serien aller Zeiten entwickelt. In vier Folgen einer Miniserie werden die Ereignisse rund um den 13-jährigen Jamie Miller und seine Familie verfolgt, nachdem er verhaftet wurde. Er soll seine Mitschülerin ermordet haben.
Nicht nur die spezielle One-Shot-Machart, sondern auch die Kernfrage, wie es dazu kommen kann, dass ein 13-Jähriger eine so grausame Tat begeht, stehen im Zentrum des Hypes.
Die Incels-Bewegung
Im Schatten der Serie steht das offensichtliche Thema, die «Incels»-Bewegung, der damit verbunden Frauenhass und das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. Ich bin zuerst in dieses Thema tiefer eingetaucht.
Wikipedia erklärt die «Incels»-Bewegung so: Incel ist die Selbstbezeichnung einer in den USA entstandenen Internet-Subkultur heterosexueller Männer, die nach Eigenaussage unfreiwillig keinen Geschlechtsverkehr beziehungsweise keine romantische Beziehung haben und der Ideologie einer hegemonialen Männlichkeit anhängen.
Eine wichtige Rolle spielt dabei die Annahme, dass 80 Prozent der Frauen sich nur für 20 Prozent der Männer interessieren und damit viele männlich gelesene Personen auf Zurückweisung stossen.
Hier wird bereits betont, wie die Frustration über fehlende Bindung und Zurückweisung zu einem Hass gegenüber weiblich gelesenen Menschen führen kann.
Besonders beschäftigt hat mich dabei etwas, worauf William Costello, wissenschaftliche Forscher und Spezialist in diesem Thema, deutlich hinweist: Ein prozentual sehr grosser Anteil der «Incels»-Bewegung sind Men of Colour. Die Bewegung ist also nicht so «männlich, weiss», wie es oft den Eindruck macht.
Meine Schlüsselszene
Als polyvagal-informierte Coachin beschäftigt mich vor allem Folge 3 der vierteiligen Miniserie. In dieser Folge wird im Austausch mit einer Psychologin das Verhalten des 13-jährigen Protagonisten Jamie Miller thematisiert.
Wenn man dabei über den Tellerrand und die offensichtliche Frage, warum ein Mensch so etwas tun kann, hinaus sieht, sieht man vor allem eines:
Einen Jungen, der zwischen Vermeidung, Verzweiflung und Aggression hin- und her wechselt. In polyvagal-informierter Sprache ist er in einem Loop zwischen sympathischer Aktivierung und dorsal-vagaler Lähmung gefangen.
Für mich hat besonders eine Szene deutlich gemacht, worum es unter all den anderen Themen dieser Serie vor allem geht:
Als die Psychologin das Gespräch abschliesst und Jamie darüber informiert, dass sie zum letzten Mal bei ihm war, überrollt ihn die Verzweiflung und er fragt sie immer wieder:
«Aber, sie mögen mich doch, oder?».
Fehlende Zugehörigkeit
Taucht man etwas weiter in die Geschichte ein, wird klar, dass Jamie zurückgewiesen wurde, oft vergeblich um die Anerkennung und Nähe seines Vaters kämpft, nicht beliebt ist, sich für hässlich hält und gern damit protzen würde, sexuell erfolgreich zu sein – es aber nicht ist.
Er erlebt keine Zugehörigkeit in seiner Peer-Gruppe, obwohl er zwei gute Freunde hat. Die Serie zeigt uns nur kleine Einblicke davon, dass diese beiden Freunde ihrerseits gemobbt und ausgelacht werden und ein schwieriges Umfeld zuhause erleben.
Es wird auch immer klarer, dass die ermordete Mitschülerin Jamie zurückgewiesen und anschliessend digital gemobbt hat.
Soziale Zurückweisung ist eine gefühlte Lebensgefahr
Die Polyvagal-Theorie von Dr. Stephen Porges ist eine Neurobiologie der Verbundenheit. Mit seiner Arbeit hat der Neurowissenschaftler in aller Deutlichkeit aufgezeigt, dass wir auf physiologischer Ebene für Verbindung gebaut sind:
Unser autonomes Nervensystem sucht und verarbeitet ständig Hinweise, die uns soziale Zugehörigkeit signalisieren: Augenkontakt, freundliche Stimmen, dass wir in einer Gruppe offen empfangen werden, dass wir gesehen und gehört werden.
Zugehörigkeit ist kein «nice to have»: Es ist eine biologisch geforderte Notwendigkeit, die unser System mit aller Kraft verlangt. Wir reagieren auf soziale Ablehnung ähnlich wie auf eine physische Bedrohung und erleben sie als Lebensgefahr.
Wir tun alles, um diese Bedrohung in den Griff zu bekommen. Gelingt uns das nicht, verfallen wir in einen dorsal-vagalen Zustand der Hoffnungslosigkeit und Taubheit.
Wir müssen über soziale Zurückweisung mehr reden!
Online lassen sich viele psychologische Erklärversuche für das Verhalten der Serienfigur finden. Gleichzeitig zieht die Serie so weite Kreise, dass in Grossbritannien die Behörden reagieren und die Serie zum Pflichtprogramm für Schulen machen wollen. Diskutiert wird vor allem über das Thema Online-Radikalisierung und die Thematik der Radikalisierung im Bereich Frauenhass.
Was für mich dabei aus einer polyvagal-informierten Nervensystem-Perspektive ein wenig zu kurz kommt, ist die Tatsache, dass fehlende soziale Zugehörigkeit, Zurückweisung und fehlende Anerkennung und Bindung zu einer elterlichen Person für unser biopsychosoziales System eine Lebensbedrohung darstellen und unser gesamtes Verhalten und Denken beeinflussen.
Zugehörigkeit und soziale Sicherheit ermöglichen dem ventralen Vagusnerv-Ast, uns zur Ruhe zu bringen, empathisch zu sein und Verbindung zu erleben. Ventral-vagale Aktivität ist die Grundlage von emotionaler Stabilität. Ohne diese Aktivität sind wir konstant alarmiert und suchen nach Orten (oder eben auch Gemeinschaften oder Strömungen) an denen wir wieder sicher und zugehörig sind.
Fazit: Zugehörigkeit erlebbar machen
Im Grunde genommen ist klar: Was Jamie getan hat, ist falsch. Ebenfalls ist klar, dass Themen wie Online-Radikalisierung, Misogynie und und entsprechende Bewegungen deutlich thematisiert gehören.
Was aus einer Nervensystem-informierten Sicht in diesem Diskurs aber deutlich zu kurz kommt, ist ein Kernproblem: Steigende Einsamkeit und die Suche nach Zugehörigkeit im digitalen Raum, die keine echte, reale Zugehörigkeit ersetzen kann.
Menschen brauchen echte, erlebbare Zugehörigkeit, um sich auf tiefster körperlicher Ebene sicher zu fühlen. Diese Zugehörigkeit kann der schnelle, digitale Kontakt nicht schaffen. Wir brauchen Massnahmen, die insbesondere jungen Menschen dabei unterstützen, echte, reale Zugehörigkeit zu erleben und mit den Gefühlen von Zurückweisung und Einsamkeit umzugehen.

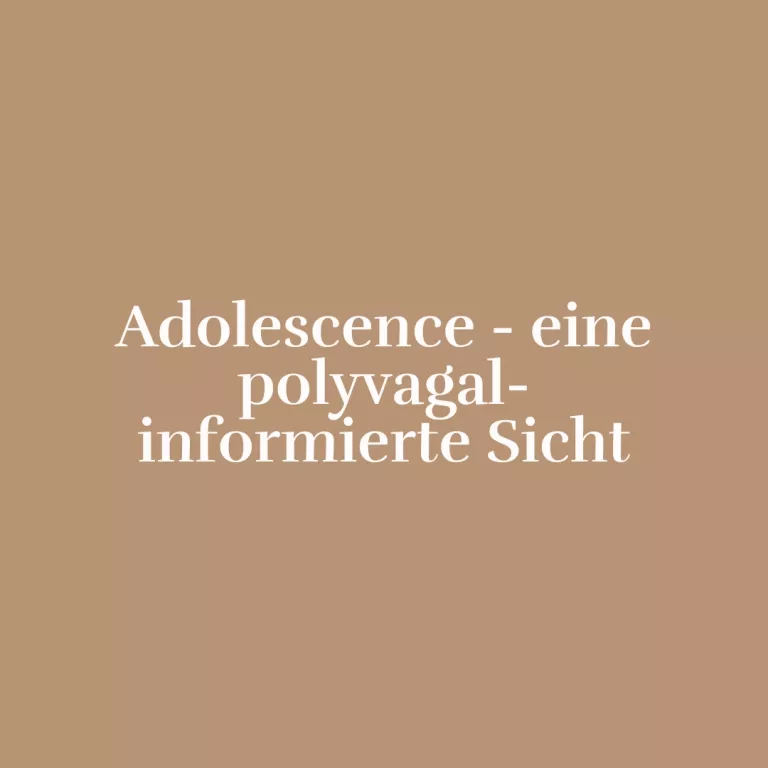
 Ich habe mich auf die alltägliche Anwendung der Polyvagal-Theorie spezialisiert. Ich arbeite im 1:1- und 1:2-Setting mit Privatpersonen, Paaren & Familien und berate Unternehmen.
Ich habe mich auf die alltägliche Anwendung der Polyvagal-Theorie spezialisiert. Ich arbeite im 1:1- und 1:2-Setting mit Privatpersonen, Paaren & Familien und berate Unternehmen.