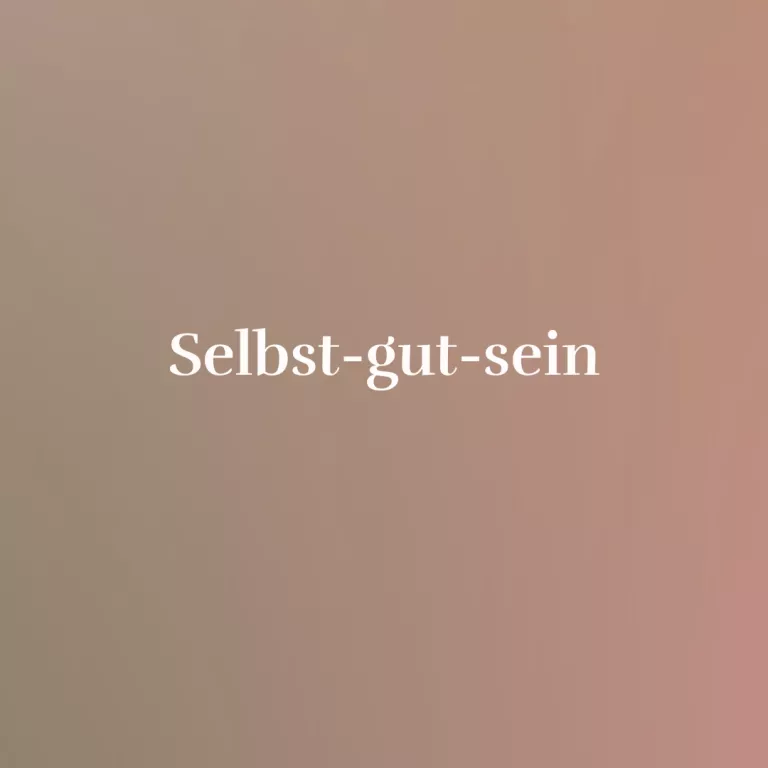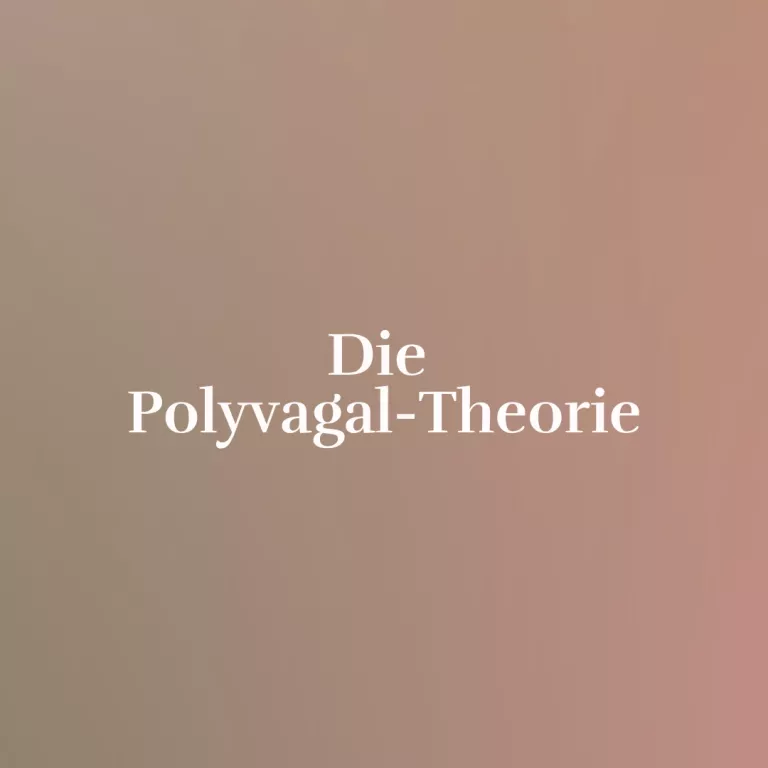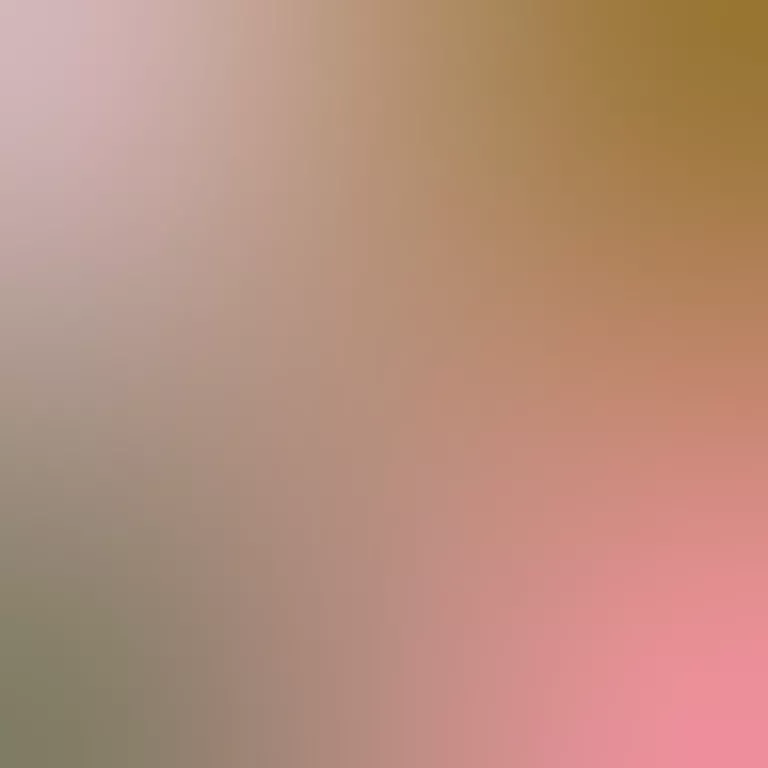Gemäss aktuellen Medienberichten nutzen rund zwei Drittel der Schweizer*innen KI-Chatbots. Was besonders auffällt: Es werden nicht nur einzelne Anfragen gestellt, sondern auch ganze Gespräche geführt oder ein aktiver Austausch zu einem Thema angestrebt. Warum sind «Gespräche mit einem Roboter» derart beliebt? Eine polyvagal-informierte Perspektive für Gründe und die Folgen.
In diesem Beitrag
- Kaffeeklatsch mit Chatbots?
- Vermeintlich «sicherer»
- Gefühlte Neutralität
- Keine Überzeugungsleistung
- Vertrauen wir einem Chatbot mehr?
- Was uns fehlt und Folgen haben kann
- Was passiert, wenn wir nur noch digital talken?
- Dinge, die in Gesprächen eine positiven Einfluss auf unsere Gesundheit haben
Kaffeeklatsch mit Chatbots?
«Hast du ChatGPT schon gefragt?» ist in kürzester Zeit eine Standard-Antwort auf viele Fragen geworden. Viele meiner Freund*innen erzählen mir auch, dass die Gespräche mit ChatGPT simuliert haben, um sich in echten sozialen Situationen sicherer zu fühlen. Gespräche mit KIs werden aber auch genutzt, um offene Fragen zu klären, sich inspirieren zu lassen oder neue Impulse für viele Dinge zu bekommen. Und ja, es werden auch viele Fragen gestellt, wie etwas funktioniert.
Vermeintlich «sicherer»
Vorhersehbarkeit und Berechenbarkeit sind für uns wichtig, um uns sicher zu fühlen. Emotionale Ausbrüche, Ablehnung und nicht erfüllte soziale Erwartungen hingegen lösen in uns eine tiefe, körperliche Verunsicherung aus. Fragen zu stellen ist für viele Menschen verunsichernd. Dazu kommt die Komponente, dass wir, um einen Menschen etwas zu fragen oder über etwas zu sprechen, aktiv Kontakt aufnehmen müssen. Diese Hürde fällt mit einer KI, die jederzeit verfügbar ist, weg.
Wir überlegen uns schliesslich nicht, ob wir ChatGPT gerade bei etwas wichtigerem stören. Im Prinzip haben wir 24/7 eine selbstlose, vorhersehbare, berechenbare Gesprächsperson ohne emotionale Affekte und Launen auf Kurzwahl und können plaudern, wann immer uns danach ist.
Mit einem Menschen ein Gespräch zu führen beinhaltet unbewusste unsichere Faktoren, die uns beeinflussen. Wir spüren, wie unser Gegenüber gerade fühlt, wie viel Zeit und Geduld es hat und ob unsere Frage und unser Thema erwünscht sind.
Und oft spüren wir eben auch, dass unser Gegenüber gestresst ist, keine Zeit und Lust hat und sich eigentlich nur Zeit nimmt, weil es muss. Oft ist uns das nicht bewusst, aber wir spüren diese tiefe Verunsicherung, die von unserem autonomen Nervensystem ausgelöst wird, in Form von Gereiztheit, Unzufriedenheit, dass wir plötzlich keine Lust mehr auf das Gespräch haben oder uns danach irgendwie leer fühlen.
Gefühlte Neutralität
Oft haben wir eine unbewusste Erwartung an ein Gespräch. Wir möchten gesehen und gehört werden und suchen nach sozialer Bindung. Manchmal möchten wir auch bestätigt werden, obwohl wir nach der Meinung unseres Gegenübers fragen (wie eine Freundin von mir es gern sagt: «Manchmal möchte ich einfach zusammen ein bisschen schimpfen»).
KIs sind vermeintlich «neutraler», weil ihre Antwort irgendwie ein Abbild vieler Meinungen ist. Sie zählen immer mehrere Punkte auf und bilden ein umfassendes Bild ab. Sie sind vermeintlich neutral und wollen uns keine Meinung aufzwingen, wie es Menschen oft tun (dass KIs sehr wohl beeinflusst werden ist ein anderes Thema).
Keine Überzeugungsleistung
ChatGPT ist es absolut egal, ob wir seiner Meinung sind. Menschen hingegen lassen sich durch andere Meinungen oft verunsichern, weil eine andere Meinung ein Angriff auf die eigenen Werte und Identität sein kann, uns aber auch voneinander trennt und wir uns nicht zugehörig fühlen. Auf diese gefühlte Verunsicherung reagieren wir oft mit Wut, Frust oder Sturheit und versuchen unser Gegenüber zu überzeugen (um uns selbst damit besser zu fühlen).
Vertrauen wir einem Chatbot mehr?
Es gibt viele Gründe, warum Menschen anderen Menschen misstrauen. Anhaltende Dysregulation, Bindungsunsicherheit, Traumata, Double-Bind-Kommunikation, anhaltende Vernachlässigung oder einfach negative Erfahrungen können in uns ein Misstrauen auslösen. Befindet sich unser autonomes Nervensystem in einem defensiven, mobilisierten Fight-Flight-Zustand, einem Freeze oder einem Totstellreflex, fühlen wir uns sozial abgeschnitten und sehen überall Bedrohung. Das macht biologisch im Grunde genommen Sinn, macht es aber auch schwierig, Menschen mit Fakten zu überzeugen. Wenn wir keinen Anker in der Sicherheit haben, sprich unser ventral-vagaler Vagusnerv-Ast nicht aktiv ist, spüren wir oft Misstrauen.
Und wenn wir Menschen misstrauen, interessieren uns Fakten nicht besonders. Wir sehen überall die berühmt berüchtigten «Fake News» und erwarten, betrogen zu werden. Es geht schliesslich unbewusst ums Überleben und Verteidigen, nicht um Fakten.
KIs hingegen erreichen uns gemäss einer US-Studie manchmal besser: In einer Untersuchung mit über 2000 Teilnehmenden konnten eine deutliche Reduktion der Überzeugung von Verschwörungstheorien erreicht werden, nachdem die Teilnehmenden sich mit einem KI-Chatbot über die entsprechende Faktenlage unterhalten hatten.
Noch ist unklar, warum dieses Ergebnis erzielt werden konnte. Wenn man aber bedenkt, dass Misstrauen ein Rolle spielt und das autonome Nervensystem bei Mobilisierung keinen Wert auf Fakten legt, liesse sich vermuten, dass eine «Maschine» weniger bedrohlich für uns ist und wir uns eher überzeugen lassen.
Was uns fehlt und Folgen haben kann
Es gibt viele Gründe dafür warum Gespräche mit KI-Chatbots für uns hilfreich und hürdenfreier sind, als «echte» Gespräche. Was aber fehlt ist die soziale Komponente, die uns eben auch reguliert. Im sozialen Austausch erfährt unser autonomes Nervensystem Co-Regulation.
Daneben lernen wir über so genannte «Rupture & Repair»-Momente. Das sind Momente, in denen die Bindung kurz unterbrochen wird, zum Beispiel weil man sich nicht einig ist oder voneinander kurz irritiert ist. Wenn wir uns durch diese Momente arbeiten und wieder Bindung erreichen können, stärkt das hingegen die Beziehung zwischen Menschen und wir können unseren Vagustonus stärken. Und wir können neue positive Bindungserfahrungen machen, die alte, negative Erfahrungen, langfristig ersetzen können.
Was passiert, wenn wir nur noch digital talken?
So einfach und verlockend Gespräche mit KI-Chatbots auch sind: Langfristig können sie uns keine spürbare soziale Bindung vermitteln und wir verlieren die Fähigkeit, gute, tiefe Gespräche zu führen.
In einer Zeit, in der viele Menschen bereits in einer dauerhaften Mobilisierung leben und wir durch globale Veränderungen mit viel gefühlter Sicherheit konfrontiert sind, ist es für unser autonomes Nervensystem immens wichtig, soziale Bindung zu erfahren.
Communities und Zusammenhalt sind extrem wichtig dafür, die Herausforderungen der nächsten Jahre zu meistern. Auf biopsychosozialer Ebene ist der menschliche Kontakt von Angesicht zu Angesicht für uns lebenswichtig. Bereits seit vielen Jahren bringen Studien psychische Krankheiten in Zusammenhang mit Einsamkeit und Isolation. Aus polyvagal-informierter Perspektive ist es für uns eine dauerhafte gefühlte Bedrohung, wenn wir keine sichere Bindung erleben.
Und wenn wir bereits Misstrauen, Bindungsunsicherheit und ein verändertes, dauerhaft mobilisiertes Nervensystem haben, das von Traumata geprägt ist, ist es für uns immens wichtig, in sicheren sozialen Bindungen wieder sichere Verbundenheit zu erleben.
Dinge, die in Gesprächen eine positiven Einfluss auf unsere Gesundheit haben
Wenn unser autonomes Nervensystem eine Neurozeption von Sicherheit empfindet, können unsere körperlichen Prozesse wie Erholung, unser Immunsystem und unsere Verdauung ideal funktionieren. Es gibt Signale der Sicherheit («Cues of Safety»), die in Gesprächen einen positiven Einfluss auf unsere Physiologie haben:
- Eine offene, freundliche Mimik
- Eine freundliche, fröhliche Stimme (Prosodie)
- Eine zugewandte, offene Haltung
- Ein geneigter Kopf
- Offene Augen
- Eine Körperhaltung, die Präsenz signalisiert
- Zustimmungslaute wie «hmm», «aha», «oh»


 Ich habe mich auf die alltägliche Anwendung der Polyvagal-Theorie spezialisiert. Ich arbeite im 1:1- und 1:2-Setting mit Privatpersonen, Paaren & Familien und berate Unternehmen.
Ich habe mich auf die alltägliche Anwendung der Polyvagal-Theorie spezialisiert. Ich arbeite im 1:1- und 1:2-Setting mit Privatpersonen, Paaren & Familien und berate Unternehmen.